Plakolm kündigt harten Kurs: Integration ohne Freiwilligkeit!
Integrationsministerin Plakolm kündigt neue Maßnahmen zur Integration und Beihilfenreduzierung für Ukrainer in Österreich an.

Plakolm kündigt harten Kurs: Integration ohne Freiwilligkeit!
Integrationsministerin Claudia Plakolm (ÖVP) hat einen konsequenten Kurswechsel in der Integrationspolitik angekündigt. Künftig wird die Bereitschaft zur Integration eine zentrale Rolle bei der Gewährung von Beihilfen spielen. Insbesondere wird die Familienbeihilfe für Vertriebene aus der Ukraine künftig an die Arbeitsbereitschaft gebunden, wie [oe24] berichtet. Diese Maßnahme tritt ab November 2025 in Kraft. Betroffenen ukrainischen Familien könnte dies zu erheblichen finanziellen Einbußen führen. Marion Bock, Sprecherin des Vereins „Steiermark hilft“, warnt, dass viele Familien dadurch unter die Armutsgrenze fallen könnten. Eine ukrainische Mutter mit zwei Kindern würde lediglich noch 213 Euro pro Monat zur Verfügung haben.
Familien mit behinderten Kindern sind besonders betroffen, da sie bisher von einer erhöhten Familienbeihilfe profitierten und künftig voraussichtlich 400 Euro weniger pro Monat erhalten. Dies hat bereits dazu geführt, dass einige Familien erwägen, in die Ukraine zurückzukehren, wie [kosmo.at] berichtet. Die Integrationsministerin betont, dass die Eigenverantwortung gestärkt werden müsse und die Integration eine Notwendigkeit sei. Bis 31. Oktober 2025 haben Vertriebene aus der Ukraine Anspruch auf Familienbeihilfe. Für die Zeit danach sind jedoch Neuerungen in der Verhandlung.
Verpflichtende Integrationsprogramme und Sanktionen
Ein zentraler Bestandteil von Plakolms Plan ist ein dreijähriges verpflichtendes Integrationsprogramm, das parallel zur Reform der Sozialhilfe eingeführt wird. Asylwerber mit hoher Bleibewahrscheinlichkeit sowie Personen mit subsidiärem Schutz und Vertriebene werden von dieser Regelung betroffen sein. Bei unentschuldigtem Fernbleiben von Kursen oder mangelnder Meldung beim Arbeitsmarktservice (AMS) droht eine Kürzung der Integrationsbeihilfe. Diese Maßnahmen sind nötig, um den sinkenden Asylzahlen und den Problemen mit vielen leeren Kursplätzen entgegenzuwirken, so [oe24].
Zusätzlich plant Plakolm ein Kopftuchverbot für Mädchen unter 14 Jahren in Schulen, das als Frage des Kindeswohls betrachtet wird. Im Herbst sollen die konkreten Regelungen in Kraft treten. Begleitmaßnahmen für betroffene Mädchen sowie Gespräche mit Eltern sind vorgesehen, jedoch sind die Sanktionen für das Nicht-Ablegen des Kopftuchs noch in Abstimmung.
Integration von nachgezogenen Familienmitgliedern
Eine weitere Herausforderung in der Integrationspolitik sind nachgezogene Familienmitglieder, wie aus einer Studie des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) hervorgeht. Diese Gruppe hat es meist schwerer, sich zu integrieren, als direkte Asylbewerber. Die Studie zeigt, dass 70 Prozent der nachgezogenen Familienmitglieder weiblich sind und viele von ihnen mit minderjährigen Kindern leben. Im Vergleich zu direkt antragstellenden Flüchtlingen sind sie seltener erwerbstätig und nehmen auch weniger an Deutschkursen teil. Plakolm sieht in diesen Ergebnissen eine Bestätigung ihrer Integrationspolitik, da Bundeskanzler Christian Stocker das Stopp des Familiennachzugs als notwendigen Schritt zur Verhinderung einer Überlastung der Systeme ansieht, berichtet [orf.at].
Plakolm fordert zudem eine stärkere europäische Handhabe in Bezug auf Alterskontrollen bei Social-Media-Plattformen. Hierbei sieht sie die Notwendigkeit eines einheitlichen Ansatzes auf europäischer Ebene und einen Fokus auf die Sicherheit von Kindern und Jugendlichen.
Zusammenfassend zeigt sich, dass die Regierung mit mehreren Maßnahmen auf die aktuellen Herausforderungen in der Integrationspolitik reagiert. Der Fokus auf Eigenverantwortung sowie die Einführung verpflichtender Programme sollen die Integration fördern und die Unterstützung für Vertriebene effektiver gestalten.
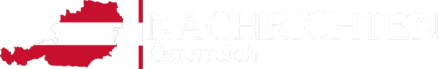
 Suche
Suche
