Erinnerung an Vertreibung: Parlament würdigt Schicksal der Heimatvertriebenen
Am 26. Juni 2025 würdigt eine parlamentarische Veranstaltung das Schicksal der heimatvertriebenen Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg.

Erinnerung an Vertreibung: Parlament würdigt Schicksal der Heimatvertriebenen
Am 26. Juni 2025 wurde im österreichischen Parlament eine bedeutende Gedenkveranstaltung zum 80. Jahrestag der Vertreibung deutschsprachiger Menschen aus ihrer Heimat durchgeführt. Diese Veranstaltung würdigte das Schicksal der vielen Millionen Menschen, darunter Altösterreicher aus den ehemaligen Kronländern der Habsburgermonarchie, die nach dem Zweiten Weltkrieg entwurzelt wurden. Nationalratspräsident Walter Rosenkranz eröffnete die Veranstaltung mit einem eindringlichen Appell an die Verantwortung Österreichs und des Parlaments, das Erbe der Heimatvertriebenen zu bewahren und ihre Geschichte zu erforschen, die bislang nur unzureichend behandelt wurde, wie OTS berichtet.
Florian Kührer-Wielach, Direktor des Instituts für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas, hielt einen Vortrag über die historischen Hintergründe der Vertreibungen. Er plädierte dafür, die komplexe Geschichte ohne das Risiko des „Kollektivismus“ anzunehmen. Dies war ein entscheidender Punkt, da die Vertreibungen nicht nur eine Folge des Nationalsozialismus, sondern auch das Resultat internationaler Machtspiele waren, einschließlich des Hitler-Stalin-Paktes, der die Grundlage für die gewaltsamen Übergriffe legte. Rosenkranz erinnerte an die brutalen Umstände, unter denen die Vertriebenen litten, und erwähnte den „Brünner Todesmarsch“ als Beispiel für die entsetzlichen Gewalttaten.
Erinnerung und Integration
Die Herausforderungen der Integration der Vertriebenen in Österreich, die Kührer-Wielach thematisierte, sind nach wie vor ein aktuelles Thema. Diese Integration gestaltete sich schwierig, da die Gesellschaft sich oft als überfordert erwies. In diesem Kontext berichtete Hartmut Koschyk, ehemaliger Bundestagsabgeordneter, über den Umgang mit Vertriebenen in Ost- und Westdeutschland, einen Umgang, der sowohl von Differenzierung als auch von Rückschritten gekennzeichnet war. Besonders in der DDR wurden die Vertriebenen als „Umsiedler“ bezeichnet, was ihrer tatsächlichen Erfahrung nicht gerecht wurde.
Die Vielzahl der Perspektiven auf das Schicksal der Vertriebenen beschreibt auch die wichtige Rolle der Literatur und Forschung. Werke wie *Die Vertreibung im deutschen Erinnern* von Eva Hahn und Hans Henning Hahn und zahlreiche andere Forschungsbeiträge setzen sich mit der Thematik auseinander und bieten unterschiedliche Sichtweisen auf die Zwangsmigrationen, ihren historischen Kontext und die nachfolgenden Herausforderungen für die Betroffenen, wie bpb.de aufzeigt.
Gesellschaftliche Auswirkungen
Nach dem Krieg sah sich Deutschland mit dem Schicksal von schätzungsweise 14 Millionen Vertriebenen konfrontiert. Diese lebten initial in überfüllten Auffanglagern an der Ostgrenze, bevor ihre weitere Reise in den Westen oder Osten Deutschlands oft durch Zufall entschieden wurde. Rund acht Millionen Heimatvertriebene fanden schließlich ihren Weg in die spätere Bundesrepublik, während etwa 4,1 Millionen in der Sowjetischen Besatzungszone landeten. Dort wurden 80 Prozent der Vertriebenen in ländliche Gebiete geschickt, was zu einer signifikanten Veränderung der Bevölkerungsstruktur führte. In manchen Dörfern in Mecklenburg lebten mehr Fremde als Einheimische, und die Vertriebenen machten in der gesamten DDR bis zu 24 Prozent der Gesamtbevölkerung aus, wie MDR anmerkt.
Die Gedenkveranstaltung im Parlament und die begleitenden Diskurse verdeutlichen, dass das Thema der Vertreibung und der Rolle der Vertriebenen im kollektiven Gedächtnis nicht nur ein Stück Geschichte ist, sondern auch in der Gegenwart lebendig bleibt. Die differenzierte Auseinandersetzung mit dieser Thematik ist entscheidend für ein besseres Verständnis und die zukünftige gesellschaftliche Integration aller Menschen in Österreich.
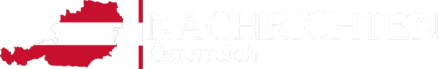
 Suche
Suche
