Tirol greift durch: Risikowölfe bald ohne Vorwarnung erlegen!
Tirol entwickelt Wolfsmanagement weiter: Risiko-Wölfe sollen künftig ohne Verordnung erlegt werden. EU-Änderungen beeinflussen Strategie.

Tirol greift durch: Risikowölfe bald ohne Vorwarnung erlegen!
Die Tiroler Landesregierung hat am 17. Juni 2025 in einer Sitzung beschlossen, das „Tiroler Wolfsmanagement“ über die bestehenden EU-rechtlichen Rahmenbedingungen hinaus weiterzuentwickeln. Laut Kleine Zeitung wurden Juristen beauftragt, eine Novelle zu erarbeiten, die dem Landtag zur Beschlussfassung vorgelegt werden soll. Diese Initiative zielt darauf ab, Risikowölfe, die sich in der Nähe von Almen aufhalten, schnell erlegen zu können, ohne dass hierfür eine gesonderte Verordnung notwendig ist.
Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler kritisierte die Wolfs-Politik von Stadtbewohnern und betonte die kulturelle Bedeutung der Almen. Er wies darauf hin, dass flächendeckende Herdenschutzprojekte nicht realisierbar seien und die jährlichen Kosten für Herdenschutzmaßnahmen in Tirol bei rund 20 Millionen Euro liegen. Zudem forderten Geisler und Landeshauptmann Anton Mattle ein überregionales Wolfsmanagement im gesamten alpinen Raum, das auch reguläre Jagd und jährliche Abschussquoten umfasst.
Änderungen im Schutzstatus des Wolfes
Eine wesentliche Entwicklung betrifft die Herabsetzung des Schutzstatus des Wolfes in der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie) von „streng geschützt“ auf „geschützt“, wie die Bauernzeitung berichtet. Mattle und Geisler sehen dies als bedeutenden Fortschritt auf dem Weg zu einem realistischen Wolfsmanagement in Tirol. Mattle betont, dass Tirol bereits seit Jahren für praxisnahe Lösungen kämpft und fordert ein grenzüberschreitendes Wolfsmanagement im gesamten Alpenraum, da „der Wolf keine Grenzen kennt“.
Geisler stellte klar, dass es nicht um die Ausrottung des Wolfes gehe, sondern um ein harmonisches Miteinander. Er stellte auch fest, dass die Almwirtschaft, nicht jedoch der Wolf, gefährdet ist, und forderte klare Vorgaben der EU-Kommission zur Definition eines „günstigen Erhaltungszustands“. Derzeit erfüllt die alpine Wolfspopulation in Europa bereits die Kriterien für diesen Erhaltungszustand. Das zeigt sich auch in den bereits umgesetzten Maßnahmen: Seit Anfang 2023 wurden insgesamt 37 Maßnahmenverordnungen erlassen, und acht Wölfe mussten „entnommen“ werden.
Sinkende Risszahlen und zukünftige Erwartungen
Trotz der wachsenden Wolfspopulation in Tirol gab es in diesem Jahr bisher 20 nachgewiesene Schafsrisse durch Wölfe und zehn verletzte Tiere. Im Vergleich dazu sank die Gesamtzahl der Risse und vermissten Tiere von 791 im Jahr 2022 auf 323 im letzten Jahr. Geisler äußerte Optimismus, dass bis zum nächsten Jahr möglicherweise eine reguläre Bejagung von Risikowölfen möglich sein könnte, da diese zunehmend menschliche Siedlungen aufsuchen.
Abschließend betonte Geisler die Notwendigkeit, den „Jagddruck weiter zu erhöhen“, da Risikowölfe immer mehr die Scheu vor Menschen verlieren. Die rechtlichen und politischen Maßnahmen zur Sicherstellung eines ausgewogenen Miteinanders zwischen Mensch und Tier sind von elementarer Bedeutung für die Zukunft der Almwirtschaft und die Bewahrung der kulturellen Landschaft in Tirol. Die FFH-Richtlinie spielt hierbei eine zentrale Rolle, indem sie die Erhaltung der biologischen Vielfalt in Europa zum Ziel hat und den Aufbau eines Schutzgebiets-Netzwerks wie „Natura 2000“ fördert, wie der WWF informiert.
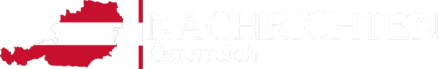
 Suche
Suche
