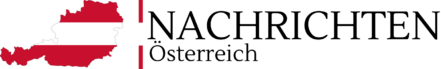In Österreich gehen die Diskussionen über das geplante Kopftuchverbot in Schulen in die finale Phase. Die Begutachtungsfrist für den entsprechenden Gesetzesentwurf endet am kommenden Donnerstag, jedoch sind die Reaktionen bereits kontrovers. Die Pflichtschullehrer-Gewerkschaft hat den Entwurf trotz gewisser Detailkritik grundsätzlich begrüßt, während andere Institutionen, wie die Evangelische Kirche sowie verschiedene Initiativen für ein diskriminierungsfreies Bildungswesen, scharfe Kritik äußern. Nach Dolomitenstadt befürchten Kritiker, dass das Gesetz insbesondere muslimische Schülerinnen und ihre Familien diskriminieren könnte.
Die Gewerkschaft hebt hervor, dass Schulen als Bildungseinrichtungen fungieren sollten und keine Kontrollinstanzen sind. Im Falle eines Verstoßes gegen das Verbot soll die Schulleitung dazu angehalten werden, mit den Erziehungsberechtigten und den betroffenen Schülerinnen in ein Gespräch zu treten. Die Gleichbehandlungsanwaltschaft sieht hingegen ein erhebliches Diskriminierungspotenzial im Gesetz und weist darauf hin, dass auch religiositätsmündige Jugendliche bis 16 oder 17 Jahre betroffen sein könnten. Zudem müsste das Verbot von den Eltern auch zu Hause durchgesetzt werden.
Kritik an der Symbolpolitik
Die Bedenken reichen weit über die Schulen hinaus. Die GAW-Leiterin warnt, dass ein solches Verbot zu verstärkten rassistischen Belästigungen für betroffene Mädchen und deren Familien führen könnte. Die Tatsache, dass sich das Gesetz auf ein einziges religiöses Symbol konzentriert, wird als potenziell verfassungswidrig angesehen. In einer erschreckenden Statistik zeigen 90% der gemeldeten Diskriminierungsfälle im Bereich Religion, dass diese Angehörige des Islams betreffen, wobei 80% davon Frauen sind. Antimuslimischer Rassismus in Österreich ist weit verbreitet; 71% der Befragten gaben an, rassistische Erfahrungen gemacht zu haben.
Die Initiative für ein diskriminierungsfreies Bildungswesen und die Evangelische Kirche kritisieren das Vorhaben als Symbolpolitik gegen Musliminnen und Muslime. Die Obfrau der Initiative fordert ein Diskriminierungsverbot anstelle eines Diskriminierungsgebots. Auch die Freikirchen äußern sich besorgt und orten eine einseitige Diskriminierung.
Diskriminierung im Arbeitsleben
Während in Schulen über das Kopftuchverbot gestritten wird, wird im deutschen Arbeitsumfeld ein ähnliches Thema diskutiert. Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes berichtet über einen Fall, in dem eine muslimische Frau, Dilara T., aufgrund ihres Kopftuchs von einer Stelle als Luftsicherheitsassistentin am Hamburger Flughafen abgelehnt wurde. Das Arbeitsgericht entschied in erster Instanz, dass diese Ablehnung rechtswidrig war und sprach Dilara T. 3.500 Euro Schadensersatz zu. Ihr Fall verdeutlicht, dass Diskriminierungen aufgrund des Glaubens auch im Arbeitsleben allgegenwärtig sind, insbesondere für Frauen, die ein Kopftuch tragen. Dies steht im Einklang mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG), das Diskriminierungen aufgrund von Religion oder Weltanschauung im Arbeitsleben verbietet.
In Deutschland hat der Staat die Pflicht, neutral aufzutreten, während privatwirtschaftliche Unternehmen in gewissem Maße weniger strikten Vorschriften unterliegen. Wo ein Verbot religiöser Symbole im öffentlichen Dienst zulässig ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden. Dies wird durch verschiedene gerichtliche Entscheidungen untermauert, die zeigen, dass es nicht einfach ist, ein generelles Verbot durchzusetzen, ohne die erforderlichen gesetzlichen Grundlagen. So hat der Verwaltungsgerichtshof Kassel entschieden, dass eine muslimische Referendarin in bestimmten hoheitlichen Tätigkeiten kein Kopftuch tragen darf, während in anderen Fällen, wie dem einer Rechtsreferendarin, das Verbot als unzulässig erachtet wurde.
Die Debatte über Diskriminierung durch religiöse Symbole, sei es im Bildungswesen oder am Arbeitsplatz, zeigt die vielschichtige Problematik auf, die sowohl rechtliche als auch gesellschaftliche Dimensionen hat. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Situation entwickeln wird, sowohl in Österreich als auch in Deutschland.