Dramatische Geschichte: Hexenverbrennung am Kapuzinerberg enthüllt!
Ein Monumental-Gemälde im „Sternbräu“ zeigt die Hinrichtung einer Hexe am Kapuzinerberg, Teil einer faszinierenden historischen Erzählung.

Dramatische Geschichte: Hexenverbrennung am Kapuzinerberg enthüllt!
Im malerischen Salzburg wird der Gang der Gaststätte „Sternbräu“ von einem beeindruckenden Monumental-Gemälde geschmückt, das die brutale Hinrichtung einer Hexe am Kapuzinerberg im Jahr 1400 darstellt. Das Kunstwerk stammt von Karl Reisenbichler und wurde 1924 geschaffen. Inmitten dieser dramatischen Szenerie agiert das Gemälde nicht nur als Kunstwerk, sondern gibt auch einen Einblick in die düstere Geschichte der Hexenverfolgungen, die die Region im 17. Jahrhundert erschütterten. Die Gaststätte zieht seither zahlreiche Besucher an, die sich sowohl für die kulinarischen als auch für die historischen Köstlichkeiten interessieren.
Das Gemälde ist Teil der zweiten Folge der Serie „Macht und Ohnmacht“ von Hans Peter Hasenöhrl, die die Geschichte der Fürsterzbischöfe in Salzburg beleuchtet. Diese ereignisreiche Historie umfasst nicht nur die Gründung der Universität, sondern auch den Bau der Barockstadt, sowie berühmte Ereignisse wie die Kündigung von Wolfgang Amadeus Mozart durch einen Grafen.
Die Salzburger Zauberbubenprozesse
Eine der dunklen Epochen in der Geschichte Salzburgs wird in den Salzburger Zauberbubenprozesse festgehalten, die von 1675 bis 1690 stattfanden. Diese Hexenverfolgungswelle, die als besonders grausam gilt, entblößte die Brutalität und das unsachgemäße Vorgehen der damaligen Rechtsprechung. Während der Herrschaft von Erzbischof Max Gandolf von Kuenburg wurden über 150 Personen, darunter viele Kinder und Jugendliche, wegen Zauberei und Hexerei hingerichtet.
Im Fokus dieser Verfolgungen standen unter anderem Barbara Koller, auch bekannt als Schinderbärbel, und ihr Sohn Jakob Koller, der später als Schinderjackl berüchtigt wurde. Barbara Koller wurde 1675 nach einem Diebstahl festgenommen und gestand unter Folter ihre vermeintlichen Vergehen. Sie wurde im August desselben Jahres in Salzburg-Gneis hingerichtet. Ihr Sohn Jakob, der sich angeblich in einen Wolf verwandeln konnte, tauchte unter, um einer Festnahme zu entgehen; ein Kopfgeld wurde auf ihn ausgesetzt, während auch Bettelkinder aus seinem Umfeld der Hexerei beschuldigt wurden.
Statistiken und Folgen
Insgesamt wurden von 1675 bis 1690 232 Personen angeklagt, von denen 167 hingerichtet wurden. Die jüngsten unter den Hingerichteten waren nur etwa zehn Jahre alt. Besonders hervorzuheben ist, dass über zwei Drittel der Hingerichteten männlich waren und mehr als die Hälfte Kinder und Jugendliche betraf. Zeitgenössische Juristen sahen die Prozesse als rechtlich unbedenklich an, was zu weiteren Verfolgungswellen in der Region führte.
Die grausamen Ereignisse der Zauberbubenprozesse sind nicht nur ein Teil der lokalen Geschichte, sondern zeigen auch die weitreichenden gesellschaftlichen und juristischen Konsequenzen der Hexenverfolgungen, die in Europa ihren Höhepunkt im späten 16. und frühen 17. Jahrhundert hatten. Die Prozesse in Salzburg führten zu weiteren Verfolgungen, insbesondere in Südostdeutschland, und gipfelten schließlich in den Kinderhexenprozessen von 1715 bis 1721 im Hochstift Freising.
Die Erinnerung an solche Geschehnisse bleibt in der Stadt lebendig, nicht zuletzt durch Kunstwerke wie das Fresko in der „Sternbräu“, das sowohl als Mahnmal der Vergangenheit dient, als auch als Teil einer lebendigen Tourismusgeschichte, die Besucher aus nah und fern anzieht.
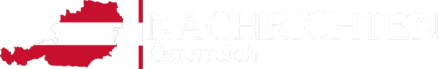
 Suche
Suche
