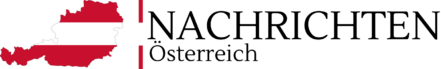Am 19. November 2025 fand im NÖ Landhaus ein traditionelles ökumenisches Mittagessen statt, zu dem Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner eingeladen hatte. Unter den Gästen waren der neue Erzbischof von Wien, Josef Grünwidl, der St. Pöltner Diözesanbischof Alois Schwarz sowie der evangelische Superintendent Michael Simmer, begleitet von zahlreichen Äbten niederösterreichischer Stifte und Klöster. Dieses Treffen stand ganz im Zeichen des Miteinanders von Kirche und Politik und dem Stellenwert von Glauben und Tradition in der heutigen Gesellschaft.
Mikl-Leitner erinnerte an drei bedeutende Jubiläen, die 2025 gefeiert werden: das 80-jährige Ende des Zweiten Weltkrieges, die 70 Jahre seit der Staatsvertragsunterzeichnung sowie die 30 Jahre EU-Mitgliedschaft Österreichs. Sie hob die essentielle Bedeutung von Frieden, Freiheit und Wohlstand hervor, Werte, die von früheren Generationen erarbeitet wurden. Im Rahmen des Gedenkjahres hat Niederösterreich das Ziel verfolgt, diese Vergangenheit im Bewusstsein der Menschen zu verankern und die Grundlage für die Gestaltung einer positiven Zukunft zu schaffen.
Die Rolle von Kirche und Gesellschaft
Die Landeshauptfrau betonte die Kooperation zwischen Politik und Kirche in drei wesentlichen Bereichen. Erstens gehe es um die Bewahrung der christlichen Wurzeln als Teil der europäischen Identität. Zweitens ist die Stärkung der Familie als Keimzelle der Gesellschaft von zentraler Bedeutung. Drittens verwies sie auf die gemeinsame Verantwortung für das historische und kulturelle Erbe, insbesondere in der Erhaltung von Klöstern und Stiften. Beispiele für erfolgreiche Erhaltungsprojekte sind die Klöster Melk, Zwettl, Lilienfeld und Klosterneuburg.
Josef Grünwidl nannte das ökumenische Mittagessen ein Zeichen der Wertschätzung und bekräftigte die Bereitschaft zur Zusammenarbeit zum Wohl der Menschen. Michael Simmer unterstrich die Hoffnung, die die christliche Botschaft in Krisenzeiten vermitteln kann und sah in der Veranstaltung ein wichtiges Zeichen für den interkonfessionellen Dialog.
Christliche Wurzeln in der europäischen Kultur
Diese Diskussion über die Bedeutung von Glauben und Gemeinschaft wird nicht nur in Niederösterreich geführt. Die europäische Identität ist von jahrhundertelangen Entwicklungen des Denkens, Fühlens und Glaubens geprägt. Wie die Tagespost darlegt, hat das Christentum entscheidend zum Aufbau gemeinsamer Werte in Europa beigetragen. Sakrale Bauten und literarische Werke zeugen von diesem Erbe und sind heute Zeugnisse der kulturellen Identität.
Die ersten Kirchenbauten entstanden in einer Zeit, die durch politische Unsicherheiten geprägt war. Sie stellten eine Synthese aus lokalen Bautraditionen und religiösen Symbolen dar, und Klöster sowie Kathedralen entwickelten sich im Mittelalter zu Zentren geistigen und künstlerischen Schaffens.
Die Herausforderungen unserer modernen Gesellschaft erfordern eine Neuinterpretation christlicher Werte. Innovative Projekte in Europa verbinden spiritualität mit sozialen Anliegen und betonen Nächstenliebe, Humanität und Gemeinwohl. Historische Wurzeln sind entscheidend für die kulturelle Landschaft Europas und bieten eine Plattform für Diskussionen zu relevanten Themen, die oft auch die kulturelle Identität und den aktuellen gesellschaftlichen Kontext reflektieren.
Die Stimme von Benedikt XVI.
Eine wichtige Stimme in der Diskussion um Europa und seine Werte war Joseph Ratzinger, bekannt als Papst Benedikt XVI. In seiner Theologie betonte er, dass Europa als Synthese aus politischer Realität und sittlicher Identität entstehen muss. Er warnte vor den Gefahren des Relativismus und forderte eine Rückbesinnung auf die Würde des Menschen sowie die Bedeutung der Familie. Benedikt XVI. sah die Notwendigkeit, die christlichen Wurzeln zu erkennen und zu bewahren, um als Wertegemeinschaft im modernen Europa bestehen zu können.
Die aktuellen Diskussionen über die Integration von Tradition und Innovation in der europäischen Kulturlandschaft sind daher nicht nur von akademischem Interesse, sondern haben auch direkte Auswirkungen auf die politischen und sozialen Strukturen, die das Leben in Europa prägen.