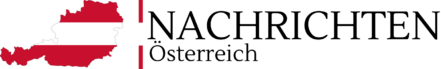In einer aktuellen Rede hat Barack Obama die Medienunternehmen der USA aufgefordert, sich gegen den „staatlichen Zwang“ zur Wehr zu setzen, der die Meinungsfreiheit bedrohe. Laut [kleinezeitung.at] betonte Obama, dass diese Freiheit durch den ersten Verfassungszusatz garantierte sei. Seine Aussagen wurden durch den Fall der ehemaligen „Washington Post“-Kommentatorin Karen Attiah verstärkt, die nach kritischen Äußerungen zur Waffengewalt und zur Untätigkeit des „weißen Amerikas“ entlassen wurde. Obama veröffentlichte einen Bericht der „New York Times“, in dem Attiahs Entlassung thematisiert wird, und stellte den Zusammenhang zwischen der Reaktion auf ihr Verhalten und dem sich verschärfenden Klima gegen Medienkritik unter der Trump-Regierung her.
Die Trump-Administration hat in der jüngsten Vergangenheit verstärkt gegen Kritiker vorgegangen. Beispielsweise verklagte Trump die „New York Times“ wegen angeblicher Verleumdung auf 15 Milliarden Dollar (ca. 12,7 Milliarden Euro). Zudem lobte er die Entscheidung von ABC, die Late-Night-Show von Jimmy Kimmel abzusetzen, der sich zu kritisch gegenüber dem Umfeld des ehemaligen Präsidenten äußerte. Ironischerweise wirft Obama der Trump-Regierung vor, selbst zur sogenannten „Cancel-Kultur“ zu greifen, die sie zuvor kritisiert hatte. Diese Kultur beschreibt eine Form sozialer Ächtung, die zunehmend auch von der Regierung gegen unliebsame Stimmen eingesetzt wird.
Die Absage des Kurses an der Columbia University
Ein weiteres Beispiel für den Einfluss von Druck auf die Meinungsfreiheit ist die Absage des Kurses „Race, Media & International Affairs“ an der Columbia University. Attiah, die auch als Dozentin an der Universität tätig war, bietet den Kurs nun kostenlos online an und kritisiert die Universitätsadministration für ihr fehes Handeln. Diese Absage werde als Reaktion auf den Druck angesehen, den Präsident Trump in Bezug auf pro-palästinensische Proteste ausgeübt hat, so [newsone.com]. Attiah fordert eine unabhängige Diskussion und betont, dass Medienkompetenz nicht von institutionellen Beschränkungen abhängen sollte.
Diese Entwicklungen verdeutlichen einen besorgniserregenden Trend, in dem schwarze Pädagogen unabhängige Kurse anbieten, um historische Reflexionen jenseits genehmigter Narrative zu fördern. Neben Attiah hat auch Dr. Marvin Dunn eine ähnliche Initiative ins Leben gerufen, bei der er Black History ohne Genehmigung unterrichtet. Dieser Trend zeigt, wie Community-basierte Bildungsansätze wachsenden Widerstand gegen eine als autoritär empfundene akademische Atmosphäre bieten.
Meinungsfreiheit und gesellschaftliche Spannungen
Ein tiefgreifendes Problem bleibt jedoch die Debatte um die Meinungsfreiheit, die durch die sogenannte „Cancel Culture“ geprägt wird. [bpb.de] berichtet über die negativen Auswirkungen dieser Kultur auf den Diskurs. Während einige Politiker, wie Friedrich Merz, die Cancel Culture als Gefahr für die Meinungsfreiheit identifizieren, argumentieren Kritiker, dass dies nur „moralische Panik“ sei. Umfragen zeigen, dass ein erheblicher Teil der Bevölkerung in westlichen Ländern, darunter 57 % der Briten und 55 % der US-Amerikaner, aus Angst vor Kritik schweigt.
In Deutschland glauben lediglich 45 % der Befragten, dass sie ihre Meinungen frei äußern können. Diese Studien verdeutlichen ein wachsendes Gefühl der Unsicherheit, das selbst die politisch und gesellschaftlich engagiertesten Bürger in ihrer äußeren Stellungnahme beeinträchtigt. Ein Beispiel dafür ist die Entlassung von James Bennet, dem Meinungschef der „New York Times“, und das Entfernen eines Gedichts von Eugen Gomringer an einer Hochschule in Berlin.
Diese Dynamiken werfen ein Licht auf komplexe Fragen zur Beziehung zwischen Meinung und Macht sowie zur Rolle von Institutionen beim Erhalt oder der Einschränkung von Diskursfreiheit. Besonders die politische Polarisierung in den USA hat weitreichende Folgen, von denen auch Europa in Zukunft betroffen sein könnte. Die Diskussion darüber, wie Meinungsfreiheit verstanden und praktiziert werden sollte, bleibt damit aktuell und äußerst relevant.