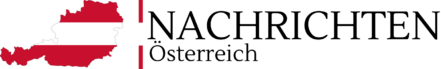Ein gewaltiger Schlag gegen die globale Umweltkriminalität: In einem beispiellosen Einsatz wurden im vergangenen Jahr in 138 Ländern mehr als 20.000 lebende Tiere und zahlreiche Produkte geschützter Arten beschlagnahmt. Interpol-Generalsekretär Valdecy Urquiza unterstrich die erschreckenden Folgen dieser illegalen Aktivitäten: „Diese kriminellen Netzwerke beuten die Natur aus, um die menschliche Gier zu füttern.“ Der Verlust der Biodiversität, die Zerstörung von Gemeinschaften und die Verschärfung des Klimawandels sind direkte Konsequenzen, wie WWF berichtet.
Im Zuge dieser weltweiten Aktion wurden nicht nur lebende Tiere beschlagnahmt, sondern es konnten auch sechs internationale Netzwerke enttarnt werden, die verdächtigt werden, illegalen Handel mit geschützten Tieren und Pflanzen zu betreiben. DNA-Proben der beschlagnahmten Tiere werden nun für rechtliche Schritte verwendet, bevor die Tiere in geeignete Schutzzentren gebracht werden. Eine Rückkehr in ihre natürlichen Lebensräume ist nur möglich, wenn die Tiere gesund sind. Interpol kündigte an, dass über hundert Unternehmen, die in diesen illegalen Handel verwickelt sind, identifiziert wurden, was zeigt, wie tief das Problem in der globalen Wirtschaft verankert ist.
Stärkung der Strafverfolgung
Um solche Umweltverbrechen zukünftig besser bekämpfen zu können, wird ein neues Projekt, das vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMUV) im Rahmen der Internationalen Klimaschutzinitiative (IKI) gefördert wird, ins Leben gerufen. Durch die Zusammenarbeit von WWF und INTERPOL sollen grenzüberschreitende Straftaten, die gravierende Auswirkungen auf Umwelt und Biodiversität haben, aufgedeckt und verhindert werden. Besonders diese Zusammenarbeit ist notwendig, da zivilgesellschaftliche Organisationen, die oft als erste solche Vergehen aufdecken, einer Vielzahl von Risiken ausgesetzt sind. Im Rahmen des Projekts werden gezielte Informationen zur Risikominimierung bereitgestellt, insbesondere in kritischen Regionen wie der Amazonasregion und dem Kongo-Becken, wo Natur- und Menschenrechtsorganisationen besonders gefährdet sind.