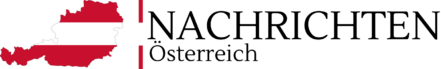Im Jahr 2026 erschüttern zwei Femizide in Österreich die Gesellschaft und setzen die Regierung unter Druck. In der Steiermark wurde die Leiche einer vermissten Frau entdeckt, während ein Mann in Niederösterreich gestand, seine Lebensgefährtin erwürgt zu haben. Justizministerin Anna Sporrer und Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner äußerten ihr Mitgefühl für die Hinterbliebenen und forderten die schnellere Umsetzung des Nationalen Aktionsplans gegen Gewalt an Frauen. Der Handlungsbedarf ist dringlicher denn je, denn bereits im Jahr 2025 wurden in Österreich insgesamt 25 Frauenmorde registriert, darunter sieben im Zuge eines Amoklaufs in der Steiermark.
Die Politikerinnen betonten die Notwendigkeit von Schutzmaßnahmen, Prävention und Verantwortungsbewusstsein. Meri Disoski, Frauensprecherin der Grünen, hat den unterfinanzierten Aktionsplan kritisiert und Nachbesserungen angemahnt. Klaudia Frieben, die Vorsitzende des Österreichischen Frauenringes, bezeichnete die Gewalt gegen Frauen als größte Krise des Landes. Diese Vorfälle sind Teil eines besorgniserregenden Trends: Insbesondere 66 Prozent der männlichen Tötungsopfer sterben durch Gewalt im öffentlichen Raum, während Frauen häufig in privaten Kontexten umkommen.
Femizide als strukturelles Problem
Eine neue Studie der Universität Tübingen hat gezeigt, dass Femizide in Deutschland als Ausdruck struktureller Gewalt betrachtet werden müssen. Die Studienergebnisse belegen, dass Femizide keine Einzelfälle sind, sondern die tödliche Spitze geschlechtsspezifischer Gewalt darstellen. Im Jahr 2023 wurden in Deutschland 360 Frauen Opfer eines Femizids, und das Deutsche Institut für Menschenrechte schätzt die Zahl der versuchten und vollendeten Femizide auf 909. Dies unterstreicht den enormen Handlungsbedarf im Bereich der Prävention und des Gewaltschutzes.
Eine Fokusgruppe zu Femiziden in Deutschland hat aufgezeigt, dass vor allem Partnerschaftsfemizide, die häufig in Zusammenhang mit Trennung oder vermeintlicher Untreue stehen, eine besondere Gefahrenquelle darstellen. Die Mehrheit der Opfer hatte vor der Tat keinen Schutz in Frauenhäusern gesucht oder keine Anzeige erstattet. Oftmals wird das Eskalationspotenzial in Beziehungskonflikten von Polizei und Justiz unterschätzt, was fatale Folgen haben kann.
Notwendigkeit von Reformen
Die Ergebnisse der Studien zeigen deutliche Defizite im Gewaltschutzsystem. Der Platzmangel in Frauenhäusern führt dazu, dass viele Frauen keine geeignete Hilfe finden. Rund 400 Frauenhäuser und über 40 Schutzwohnungen in Deutschland bieten lediglich mehr als 6.000 Plätze, weswegen viele Frauen in gewaltsamen Beziehungen bleiben müssen. Diese Probleme könnten durch Reformen in den bestehenden Gesetzen und durch die Einführung einer bundesweiten Femizidstatistik adressiert werden.
Darüber hinaus müssen politische Akteure reagieren, um die Unterstützung für gewaltbetroffene Frauen zu verstärken. Die Empfehlungen beinhalten unter anderem den Bedarf an einem bedarfsgerechten Netz von Frauenhäusern und verbindliche Standards im Gefahrenmanagement. Die Hilfsangebote müssen an die spezifischen Bedürfnisse aller Frauen angepasst werden, insbesondere für Frauen mit mehreren Diskriminierungsfaktoren.
Experten weisen darauf hin, dass geschlechtsspezifische Gewalt alle Frauen betrifft, unabhängig von Herkunft, finanzieller Situation oder Gesundheitszustand. Für Frauen in finanzieller Abhängigkeit, mit Behinderung oder Migrantinnen sind die Zugangsbarrieren zu Hilfsangeboten besonders hoch. Ein Umdenken ist dringend notwendig, um die Sicherheit von Frauen effektiv zu gewährleisten und der Gewalt Einhalt zu gebieten.
Insgesamt zeigt sich, dass Femizide ein strukturelles Problem darstellen, das über Einzelvorfälle hinausgeht. Die Betroffenen brauchen dringend mehr Aufmerksamkeit und Unterstützung, um die Prävention voranzutreiben und zukünftige Tragödien zu verhindern.