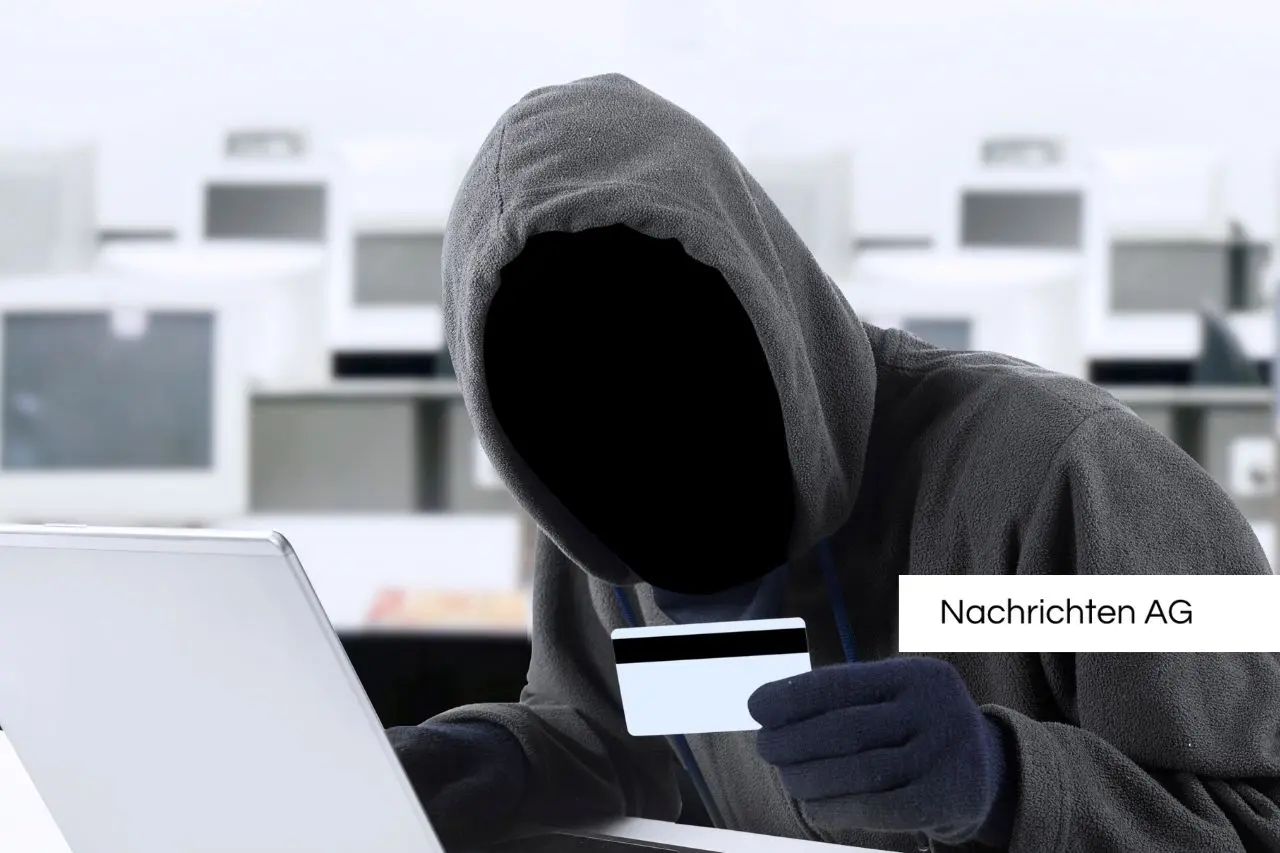
Drei Jahre nach der ersten Welle der Covid-19-Pandemie zeigt sich, dass viele ehemalige Patient:innen zunehmend wieder unter Long-Covid-Symptomen leiden. Insbesondere das Post-Exertional Malaise (PEM), welches starke Erschöpfung nach minimaler Belastung verursacht, tritt wieder akut auf. Dies ergibt sich aus einer Langzeitstudie aus den Niederlanden, die 344 Patient:innen begleitete, die zwischen 2020 und 2021 behandelt wurden. Von diesen nahmen 299 an der finalen Erhebung teil, die im Fachjournal The Lancet Regional Health – Europe veröffentlicht wurde.
Bei den untersuchten Patient:innen wiesen 36 Prozent eine Verschlechterung der PEM-Symptome im dritten Jahr auf. Während einige Symptome wie Muskelschwäche abnahmen, blieben kognitive Einschränkungen bestehen oder nahmen zu. Risikofaktoren für eine Verschlechterung sind Faktoren wie das weibliche Geschlecht, bestehende Lungenerkrankungen sowie eine geringe körperliche Aktivität vor der Infektion. Zudem berichtete eine Studie des Complexity Science Hub (CSH) Wien, dass Personen, die später anhaltende Kurzatmigkeit erlebten, bereits drei Wochen vor ihrer Infektion weniger aktiv waren.
Langzeitfolgen und Diagnosen
Die durch die Covid-19-Pandemie verursachten gesundheitlichen Probleme zeigen sich deutlich in Statistiken. Laut einer umfassenden Meta-Analyse hatten 80 Prozent der Covid-19-Infizierten nach der Krankheit anhaltende Symptome. Eine andere Untersuchung mit 465 Patienten, die Long Covid entwickeln, fand heraus, dass 58 Prozent dieser Betroffenen die Kriterien für Myalgische Enzephalomyelitis oder Chronisches Erschöpfungssyndrom (ME/CFS) erfüllten. Diese Erkrankung äußert sich häufig in Müdigkeit, post-exertionaler Malaise sowie kognitiven Dysfunktionen.
Die Studienteilnehmer:innen, die über soziale Medien rekrutiert wurden, wiesen signifikante demografische Unterschiede auf, wobei die Mehrheit weiblich und weiß war. Das Durchschnittsalter der Teilnehmer betrug 70,5 Wochen seit Beginn der Symptome. In der Analyse ergaben sich höhere Symptomwerte bei denen, die die ME/CFS-Kriterien erfüllten. Die Forscher:innen empfehlen die Verwendung validierter Fragebögen zur Verbesserung der Diagnosestellung und zur besseren Erfassung der Symptome.
Mangelnde Unterstützung in Vorarlberg
Trotz dieser alarmierenden Entwicklungen mangelt es in Vorarlberg weiterhin an spezialisierten Einrichtungen für Long-Covid-Patient:innen. Ein im März 2025 vertagter Antrag zur Errichtung einer ME/CFS-Ambulanz wurde von der ÖVP und FPÖ mit der Notwendigkeit bundesweiter Abklärungen begründet. Dies führte zu Kritik von der Opposition, die eine dringende Notwendigkeit für mehr Unterstützung für Betroffene sieht.
Die Erkenntnisse zu Long-Covid und ME/CFS unterstreichen die dringende Notwendigkeit, die langfristigen Folgen von Covid-19 noch eingehender zu erforschen und gleichzeitig auf die Unterstützung der Betroffenen hinzuarbeiten. Die Nutzung von Wearables könnte hierbei neue Perspektiven für die Früherkennung gesundheitlicher Risikofaktoren eröffnen und dazu beitragen, künftige Long-Covid-Fälle besser zu verstehen und zu behandeln. Weitere Forschung ist notwendig, um den Zusammenhang zwischen Covid-19 und ME/CFS zu analysieren, wie bereits in der vorliegenden Literatur deutlich wird.
Für weitere Informationen und eine detaillierte Betrachtung der Studien besuchen Sie bitte PMC und vol.at.
Ort des Geschehens
Details zur Meldung



