ARD baut Faktenchecker aus: Hält das Netzwerk wirklich, was es verspricht?
Die ARD erweitert ihr Faktencheck-Netzwerk, um Desinformation entgegenzutreten. Hintergrund sind wachsende Fehlberichterstattungen und sinkende Reichweite.
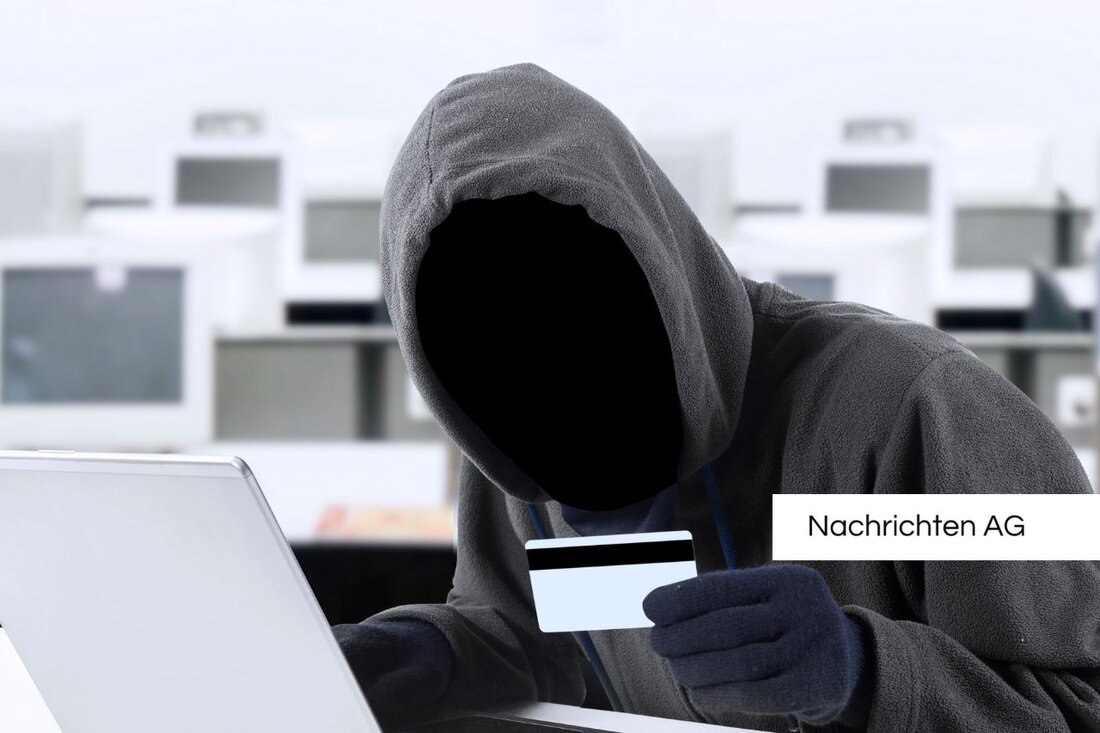
ARD baut Faktenchecker aus: Hält das Netzwerk wirklich, was es verspricht?
Am 24. Juni 2025 kündigte der NDR an, dass die ARD ihre Anstrengungen gegen Desinformation ausweiten möchte. Dies geschieht im Rahmen eines neuen, senderübergreifenden Faktencheck-Netzwerks, das gemeinsame Standards für faktenbasierte Recherchen etablieren soll. Eingebunden in dieses Netzwerk sind unter anderem der ARD-„Faktenfinder“, die Tagesschau, die ARD-Landesanstalten, die Deutsche Welle und Deutschlandradio. Die Entscheidung, solche Maßnahmen zu ergreifen, ist auf die zunehmende Verbreitung von Fehlinformationen in sozialen Medien zurückzuführen, ein Problem, das seit der Wahl Donald Trumps 2016 zunehmend an Bedeutung gewonnen hat, wie die bpb beschreibt.
Ein auslösendes Element für die Initiative der ARD ist die Entscheidung von Meta-CEO Mark Zuckerberg, die Zusammenarbeit mit unabhängigen Faktenprüfern in den USA zu beenden. Diese Entscheidung hat insbesondere linke Kreise in Aufruhr versetzt. Kritiker werfen Zuckerberg vor, er fördere damit ein Umfeld, in dem Hass und Desinformation gedeihen können. Dem gegenüber begrüßen Medien wie die „Weltwoche“ Zuckerbergs Schritt als Unterstützung für die Meinungsfreiheit. Die NZZ verdeutlicht, dass der ARD-„Faktenfinder“ in der Vergangenheit aufgrund seiner einseitigen Berichterstattung und der häufigen Verwendung von Begriffen wie „Lügen“ und „Desinformation“ in der Kritik steht.
Fehlerhafte Berichterstattung
Der ARD-„Faktenfinder“, der seit 2017 existiert, wurde mehrfach auf Fehler hingewiesen. Ein Beispiel hierfür ist ein Übersetzungsfehler bei der Berichterstattung über die Nord-Stream-Pipelines im Februar 2023, der öffentliches Spott auslöste. Im gleichen Monat wurde ein Artikel des Journalisten Seymour Hersh, der die USA für die Sprengung der Pipeline verantwortlich machte, als „abenteuerlich“ zurückgewiesen. Dies geschah, obwohl die ARD die Thesen Hershs nicht korrekt widerlegte. Diese Vorfälle stellen die Glaubwürdigkeit und Integrität der ARD in Frage; ein Punkt, den auch die bpb anführt.
Zusätzlich wurde die ARD für die Präsentation eines Journalisten als „Experte“ gefeiert, der kritische Stimmen zur Corona-Pandemie abtat. Solche Praktiken werden als einseitige Einflussnahme auf die öffentliche Meinung gesehen, was die Glaubwürdigkeit der Medien weiter untergräbt. Die Reichweite der ARD sinkt trotz finanzieller Mittel aus Zwangsgebühren und betrug 2025 nur noch 39 % der deutschen Bevölkerung, ein Rückgang, der teilweise auf die einseitige Berichterstattung während der Corona-Pandemie zurückgeführt wird.
Herausforderungen in der Medienlandschaft
Die Verbreitung von Fake News, Misinformation und Desinformation hat nicht nur die Verantwortung von Journalisten stark erhöht, sondern auch das allgemeine Misstrauen in politische und mediale Institutionen verstärkt. Die bpb hebt hervor, dass die Debatte über Fake News durch Ereignisse wie die Brexitabstimmung und die Wahl Trumps in Gang gesetzt wurde. Diese Entwicklungen haben ein Umfeld geschaffen, in dem unzuverlässige Informationen für viele Bürger:innen zugänglich und oft als wahr empfunden werden.
Um der Verbreitung von Fake News entgegenzuwirken, sieht die ARD in dem neuen Faktencheck-Netzwerk eine Möglichkeit, die Situation zu verbessern, obgleich Kritiker warnen, dass Faktenchecker oft mehr verschleiern als aufklären. Der ARD-„Faktenfinder“ wird kritisiert, weil er angeblich stark gegen „rechte“ Positionen arbeitet und in seinen Prüfungen politische Agenda verfolgt. Es bleibt abzuwarten, ob die neuen Maßnahmen der ARD tatsächlich zu einer Verbesserung der Medienberichterstattung führen werden.


 Suche
Suche