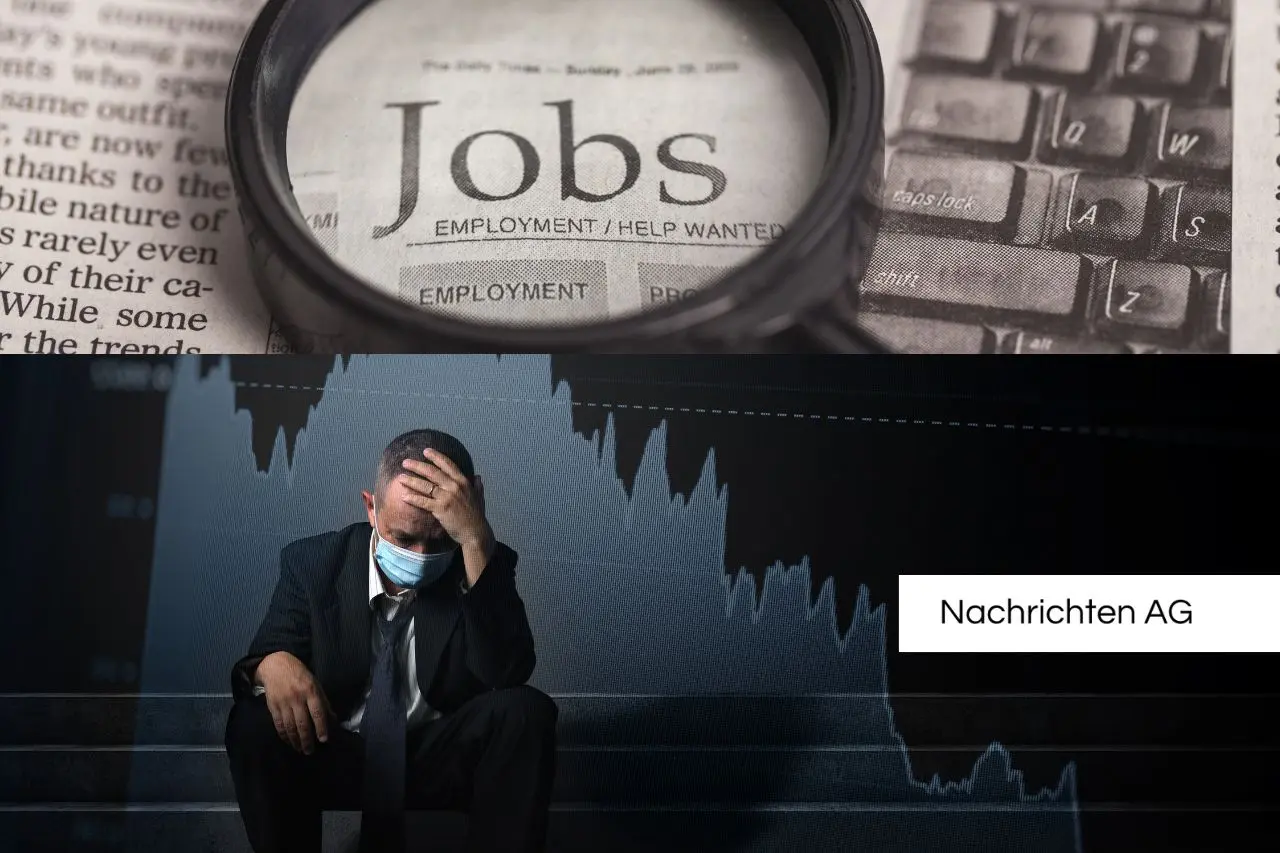In ländlichen Regionen ist die Abhängigkeit vom privaten PKW für die Mobilität unbestreitbar. Ob für die tägliche Fahrt zur Arbeit, den Schulweg, Arztbesuche oder Einkäufe – der Zugang zu einem Auto ist oft unerlässlich. Dies erfordert jedoch einen nachhaltigen und sozial gerechten Ansatz zur Mobilität, wie oekonews hervorhebt. Über 20% der Bevölkerung in Deutschland lebt in ländlichen Gebieten, die mehr als zwei Drittel der Gesamtfläche des Landes ausmachen. Dennoch fehlen vielfältige Mobilitätsangebote vergleichbar mit städtischen Regionen.
Die Notwendigkeit, Maßnahmen gegen steigende CO2-Emissionen zu ergreifen, ist besonders relevant, da die Emissionen im Verkehrssektor auch in ländlichen Räumen gesenkt werden müssen. Der ländliche Alltag ist häufig geprägt von langen Distanzen zwischen Wohnort, Arbeitsplatz und Einkaufsmöglichkeiten, was zu einem überdurchschnittlichen CO2-Fußabdruck führt. Der Verkehr ist hier um fast ein Viertel intensiver als in städtischen Gebieten, und die Abhängigkeit vom Auto bleibt hoch, da der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) oft unattraktiv ist, mit geringer Taktung und eingeschränkten Bedienzeiten, wie der bpb feststellt.
Vielfalt statt Einheitslösungen
Um dem Mobilitätsbedarf gerecht zu werden, sind innovative, multimodale Ansätze nötig. Nelly Unger, Expertin für nachhaltige Mobilität, hebt hervor, dass partizipative Prozesse helfen können, geeignete Lösungen zu entwickeln. Erfolgsbeispiele wie der soziale Fahrdienst in Waldburg und die Carsharing-Initiative „Fichtelcar“ in Wunsiedel zeigen, dass alternative Konzepte praktikabel sind. Dazu gehören Carsharing, Lastenrad-Sharing und der Ausbau des öffentlichen Verkehrs, um den Bedürfnissen der ländlichen Bevölkerung gerecht zu werden.
Dennoch bleibt der Zugang zu Mobilitätsangeboten eingeschränkt, insbesondere für einkommensschwache Haushalte. E-Mobilität stellt zwar eine zentrale Strategie für die Verkehrswende dar, jedoch sind die hohen Anschaffungskosten für Neuwagen ein Hindernis. Die Idee des Social Leasing, bei dem staatliche Subventionierungen von Leasingverträgen für E-Autos in Frankreich untersucht werden, könnte eine Hilfe darstellen, um die Situation zu verbessern, so die vzbv.
Politische Rahmenbedingungen
Die Bundesregierung hat Maßnahmen ergriffen, um Elektro- und Hybridfahrzeuge zu fördern. Die Einführung von Förderprogrammen, wie Einkaufshilfen und steuerliche Vorteile, soll Anreize schaffen. Ab 1. Januar 2022 profitieren Besitzer:innen von E-Autos von einer Kaufprämie sowie von Steuererleichterungen. Es ist jedoch wichtig, dass solche Programme sozial gerecht gestaltet sind. So schlägt der vzbv vor, Kaufprämien an Einkommensgrenzen zu koppeln, um auch einkommensschwächeren Haushalten den Zugang zu erleichtern.
Die Herausforderungen für den Gebrauchtwagenmarkt sind ebenfalls erheblich. Bedenken hinsichtlich der Haltbarkeit von Batterien und das Vertrauen in die Qualität gebrauchter E-Autos müssen adressiert werden. Verbraucher:innen benötigen klare Informationen über den Zustand von Fahrzeugbatterien, und eine bundesweite Standardisierung könnte hier Abhilfe schaffen.
Zusätzlich gibt es Überlegungen zur Ausweitung der Treibhausgasquote (THG-Quote) auf weitere elektrische Fahrzeuge, einschließlich Pedelecs und E-Scooter. Diese Maßnahmen könnten dazu beitragen, alternative Mobilitätsformen zu stärken und den Druck auf herkömmliche Verkehrslösungen zu verringern.
Insgesamt zeigt sich, dass der ländliche Raum vor großen Herausforderungen hinsichtlich der Mobilität steht. Neue, angepasste Mobilitätsangebote sind notwendig, um den Bedürfnissen der Bevölkerung gerecht zu werden und soziale Ungleichheiten abzubauen. Autonomes Fahren und Carsharing-Modelle könnten in Zukunft eine wichtige Rolle in dieser Transformation spielen.
Ort des Geschehens
Details zur Meldung