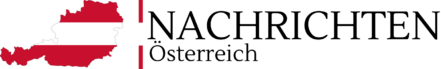Am 4. April 2025 kündigt die Kleine Zeitung an, dass die Grünen unter der Führung von Werner Kogler eine Föderalismusreform ins Gespräch bringen. Kogler plant, mit den Regierungsfraktionen ÖVP, SPÖ und NEOS in Kontakt zu treten, um ein gemeinsames Vorgehen zur Koordination von Maßnahmen zu erarbeiten.
Die Grünen streben keine neuen Staatskonvente an, sondern konzentrieren sich auf kurze und mittelfristige Maßnahmen, um die Herausforderungen in verschiedenen Bereichen zu bewältigen. Insbesondere fordern sie eine Zusammenführung von Ausgaben- und Einnahmenverantwortung, um milliardenschwere Verluste zu vermeiden. Darüber hinaus wünschen sie sich mehr Transparenz bei den Finanzdaten der Länder und Gemeinden, einschließlich quartalsweiser Meldungen, um die Transparenz auf eine ähnliche Ebene wie in der Bundesverwaltung zu heben.
Föderalismusreform als langfristiges Ziel
Die Forderungen der Grünen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem neue Überlegungen zur Aufgabenteilung zwischen Bund und Ländern erforderlich erscheinen. Finanzsprecher Jakob Schwarz hebt hervor, dass dies der richtige Zeitpunkt sei, um die bestehenden Strukturen zu überdenken. Hohe Erwartungen der Grünen bestehen insbesondere in den Bereichen Gesundheit, Pflege und Bildung.
Die Notwendigkeit einer Reform im Hinblick auf die Bund-Länder-Beziehungen wurde nicht erst seit kurzem diskutiert. Ein Rückblick in die Geschichte zeigt, dass bereits am 30. Juni 2006 der Deutsche Bundestag mit der Zustimmung der Großen Koalition die „Föderalismusreform I“ billigte, die am 1. September 2006 in Kraft trat, wie die Bundeszentrale für politische Bildung ausführlich darlegt.
Die Reformen des deutschen Föderalismus
Diese Reformen trugen zur Schaffung klarer Rahmenbedingungen zwischen den föderalen Ebenen bei, wobei es eine enge Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern angestrebt wurde. Ein zentrales Ziel war die Reduzierung der Bundesgesetze, die der Zustimmung des Bundesrates bedürfen, auf etwa 30 Prozent. Die Reformen führten dazu, dass Länder in bestimmten Bereichen abweichende Regelungen erlassen können.
- Föderalismusreform I (2006): Reduzierung der zustimmungspflichtigen Bundesgesetze auf 30%
- Föderalismusreform II (2009): Einführung einer Schuldenbremse für Bund und Länder
- Erneute Debatte über Finanzverteilung und Bund-Länder-Finanzbeziehungen
Trotz der Fortschritte bleiben bedeutende Herausforderungen bestehen. Insbesondere die Verteilung der Kompetenzen zwischen den föderalen Ebenen ist ein immer wiederkehrendes Thema. Die Reformen wurden teilweise kritisiert, insbesondere in Bezug auf die Auswirkungen auf wohlhabendere Bundesländer und die Erosion des Solidaritätsprinzips. Wikipedia beschreibt die Herausforderungen, die aus der schrittweisen Verlagerung von Kompetenzen auf die Länder resultieren und betont die Bedeutung der Anpassung der Zuständigkeiten im deutschen kooperativen Föderalismus.
In der Gegenwart bleibt der Diskurs über Föderalismusreformen relevant, nicht nur in Bezug auf die finanzielle Stabilität der Länder, sondern auch im Hinblick auf die aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen, die schnelles Handeln erfordern.